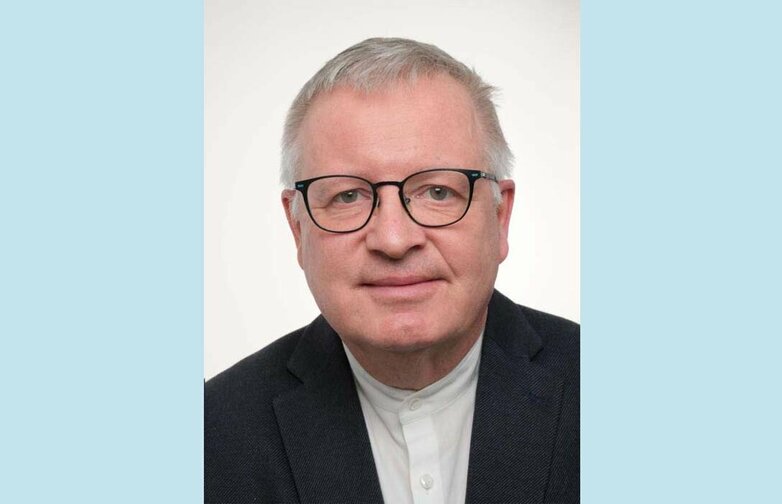Auf der Grundlage der Soziallehre der Kirche, insbesondere dem Solidaritäts- und Subsidiaritätsprinzip, setzt sich die KAB für einen Sozialstaat ein, der Ausgrenzung beseitigt und den sozialen Aufbau und Zusammenhalt unsere Gesellschaft sichert und fördert.
Wort in Bewegung
Immanuel Kant (übrigens: happy Birthday!) empfand größte Hochachtung zwei Phänomenen gegenüber, die er sich nicht erklären konnte: der bestirnte…
Archiv
Hier finden Sie die Nachklänge aus dem letzten Jahr
zum Archiv
Gottesdienstvorlage
Gott schaut auf die Niedrigen - Litugische und Homiletische Elemente zum Thema "Prekäre Arbeit".
Download als pdf-Datei
Therese Studer

Therese Studer, die am 22. September vor 160 Jahren in Senden an der Iller geboren wurde, verlor früh ihre Mutter und musste als Achtjährige bereits für den eigenen Lebensunterhalt sorgen. Mit 14 Jahren wird sie Akkordarbeiterin in einer Zündholzfabrik in Altenstadt an der Iller. Zwischenzeitlich arbeitet sie als Dienstbotin, ohne geregelte Arbeitszeit, ohne sozialen Schutz. Als sie mit 22 Jahren in einer Spinnerei arbeitet, erlebt sie, wie die jungen Mädchen und Frauen ausgebeutet werden. Für sich nutzt sie die geregelten Arbeitszeiten, um sich zu bilden. „Mir kam der Gedanke, in einer Fabrik Arbeit zu nehmen, um die Freizeit für meinen Wunsch zu lernen dienstbar zu machen.“ Sie arbeitet 22 Jahre dort und wohnt in einem Arbeiterinnenwohnheim. Ihren Wunsch, Lehrerin zu werden, erreicht sie nicht. Dennoch ist sie stolz, dass sie als Arbeiterin mit zwölf Stunden am Tag im Akkord an der Maschine ihren Lebensunterhalt bestreiten kann.
Soziale Rechte der Arbeiterinnen
Beeinflusst und fasziniert von anderen Frauen, wie die Frauenrechtlerin Elisabeth Gnauck-Kühne, wird sie aktiv und setzt sich für die sozialen Rechte der Arbeiterinnen ein. Als sie im Sommer 1906 zu einer Versammlung in Aschaffenburg einlädt, kommen 159 Arbeiterinnen und erklären ihren Beitritt. Unter ihrer Führung wuchs der Arbeiterinnenverein auf 460 Mitglieder. Zwei Jahr später ist es der Verbandspräses Carl Walterbach, der sie überzeugt, Verbandssekretärin der süddeutschen Arbeiterinnenvereine zu werden. Am 21. Juni 1908 tritt sie ihr Amt an und ist somit die erste Arbeiterinnen-Sekretärin, oder wie sie liebevoll genannt wurde: „unsere Verbandsmutter“.